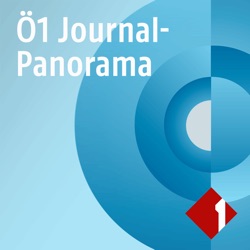Afleveringen
-
Bei der Wiener Landtagswahl am 27.4. treten sieben Parteien im gesamten Stadtgebiet, also in allen Wahlkreisen an. Wir begleiten ihre Spitzenkandidat:innen und fragen nach ihren Chancen beim Wahlvolk und bei Experten.
Dass die SPÖ wieder auf Platz Eins landen wird, davon ist auszugehen; die Frage ist, wie groß der Abstand zu den nächsten Parteien wird und mit wem die SPÖ dann eine Koalition eingehen wird. -
Das Erbe des "Unvollendeten"
Papst Franziskus ist tot. Er hat viele Hoffnungen geweckt, neue Akzente gesetzt - konkrete Reformen wurden in den zwölf Jahren seiner Amtszeit aber kaum umgesetzt. Der Vatikan-Experte Marco Politi nennt ihn in seinem neuen Buch "Der Unvollendete".
In einer weltpolitisch schwierigen Situation muss nun ein neuer Papst gewählt werden. Werden die globalen Krisen die Entscheidung der Kardinäle bestimmen? Oder werden innerkirchliche Erwägungen im Vordergrund stehen?Darüber diskutieren:
Doris Helmberger-Fleckl, Chefredakteurin der Wochenzeitung "Die Furche"
Dietmar Neuwirth, Tageszeitung "Die Presse"
Paul Wuthe, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur "Kathpress"Diskussionsleitung: Markus Veinfurter
-
Zijn er afleveringen die ontbreken?
-
Im Sudan herrscht laut UNO die größte humanitäre Krise der Welt. 25 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht, rund 12 Millionen vertrieben durch den Krieg, derseit zwei Jahren im Land tobt.
Der Armeechef und de facto-Machthaber des Landes kämpft mit der nationalen Armee gegen seinen ehemaligen Stellvertreter, der die grausame RSF-Miliz befehligt. Vor kurzem haben Regierungstruppen die Hauptstadt Khartum zurückerobert; die Kämpfe in weiten Landesteilen dauern an. Vor allem im Westen, in der Region Darfur, kommt es zu schweren Menschenrechtsverbrechen und ethnischen Säuberungen. Ein Lokalaugenschein in dem bitterarmen Land.
-
Sie werden in Bordellen Westeuropas und auf dem Straßenstrich zur Prostitution gezwungen. Davor war ihnen Liebe vorgetäuscht oder ein besseres Leben versprochen worden: Die Rede ist von den Opfern von Menschenhandel, den der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg als eine moderne Form der Sklaverei definiert. Viele der Opfer kommen aus Bulgarien.
Meist sind die betroffenen Frauen und Männer Analphabeten, leben in großer Armut und geraten leicht in die Fänge organisierter, krimineller und ausbeuterischer Gruppierungen.
Sie werden nicht nur zur Prostitution gezwungen und häufig misshandelt, sondern manchmal bezahlen sie auch mit dem Tod, wie im Fall eines 16-Jährigen, der im vergangenen Herbst in Wien-Favoriten von seinem Freier mit einer Axt grausam ermordet wurde.
Bulgarien hat keine robuste Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels, im Gegenteil. Auch die Zusammenarbeit mit Zielländern wie Österreich lässt viel zu wünschen übrig. -
Japans Gesellschaft altert stark. Viele über 65Jährige leben allein, und jedes Jahr sterben Tausende einsam in ihren vier Wänden. Was macht die Gesellschaft dagegen? Begegnungszentren für alte Menschen sind ein Mittel.
-
Seitdem sich in Uganda der Popstar Bobi Wine als Präsidentschaftskandidat aufstellen hat lassen, ist die Kunst- und Kulturszene im Visier des Regimes. Denn Wine ist es gelungen, mit Songtexten über die Missstände im Land die Jugendlichen zu mobilisieren.
Seitdem müssen sich Ugandas Künstler und Künstlerinnen in Acht nehmen, denn die Geheimdienste beobachten, was Schriftsteller schreiben, Musikerinnen singen und Dichter texten. Der Schriftsteller Kakwenza Rukirabashaija beispielsweise, der mit seinen Fabeln das Regime an den Pranger stellte, wurde 2021 verhaftet und brutal gefoltert.
Doch jetzt bauen die Mitglieder des Kunst- und Kulturzentrums 32Degrees East in Ugandas Hauptstadt Kampala ein neues, einzigartiges Gebäude – es ist massiv und nachhaltig gebaut, ein Ökobunker gewissermaßen, in dem die Künstler:innen wieder einen sicheren Freiraum für sich etablieren wollen. -
Ecuador war einst ein eher unaufgeregtes Land, bekannt für die Galapagos-Inseln, hohe Berge in den Anden und schöne Kolonialstädte. Mittlerweile jedoch ist es zur Drehscheibe im internationalen Drogenhandel geworden. Kokain aus den Nachbarstaaten Kolumbien und Peru wird über Ecuadors Häfen verschifft – vor allem nach Europa. Und Kartelle und Drogenbanden haben die Kontrolle über ganze Landstriche übernommen, Gewalt und Korruption sind explodiert.
Der rechtsgerichtete Präsident Daniel Noboa erklärte den „Narco-Terroristen“ den Krieg, schickte das Militär auf die Straßen und in die Gefängnisse und regierte im Ausnahmezustand. Seine Politik der „harten Hand“ hat viele Fans – doch die Kritik wächst. Denn zunehmend werden die Soldaten auch selbst mit Verbrechen und Korruption in Verbindung gebracht.
Ob sich Noboa in der Stichwahl am 13. April gegen seine linke Herausforderin Luisa Gonzalez durchsetzen kann, ist offen. -
80 Tage ist er an der Macht, seither sorgt US-Präsident Donald Trump mit seinen Ankündigungen und Maßnahmen fast täglich für Schockwellen weit über die USA hinaus. Seine jüngst verkündete Zollpolitik straft fast jedes Land mit unterschiedlich hohen und nach einer ziemlich schrägen Formel berechneten Zöllen ab. Damit ruft Trump praktisch einen Handelskrieg aus und könnte eine globale Rezession auslösen. Schon sprechen viele vom Ende der regelbasierten Handelsordnung unter dem Dach der WTO.
Auch in den USA sorgen die drohenden Preissteigerungen, aber auch Trumps Lust-am-Schock-Politik für große Verunsicherung. Hunderttausende protestierten am Wochenende gegen die Massenentlassungen von Beamten, massive Kürzungen bei Förderprogrammen und gegen den großen Einfluss von Tech-Milliardären auf die Politik.
Welche Ziele verfolgt der US-Präsident mit seinen mitunter willkürlich anmutenden Maßnahmen? Wie sollte die EU reagieren? Und erleben wir gerade das Ende der Weltmacht USA? -
Vor 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende gegangen. Mitte April 1945 ist Wien befreit worden, das KZ Mauthausen erst am 5. Mai, im Westen und Süden Österreichs wurde noch gekämpft, am 8. Mai war dann alles vorbei.
Unter den Zig-Millionen Toten des Krieges waren auch hunderttausende Menschen aus Österreich - beileibe nicht nur Soldaten.
Wo sind eigentlich all diese Menschen begraben - und wo kann man ihrer gedenken? -
Seit genau einem Monat ist die Dreierkoalition im Amt, am 3. März ist die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt worden. Zustande gekommen ist sie erst im zweiten Anlauf, nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen von allen mehr Kompromissfähigkeit eingefordert hatte.
Seither gab es erste Regierungsbeschlüsse, allerdings wurde auch bekannt, dass das Budgetdefizit weit höher ausfällt als bisher angenommen.
Was bedeutet die schlechte budgetäre Ausgangslage für die Regierungsarbeit? Und wie hat sich die erste Dreierkoalition seit 1947 bisher geschlagen?Darüber diskutieren:
Peter Hajek, Meinungsforscher und Politologe
Andreas Koller, Salzburger Nachrichten
Petra Stuiber, Der Standard -
Die Hinterbrühl, eine kleine Marktgemeinde nahe Mödling, war aufgrund ihrer idyllischen Lage im Wienerwald lange ein beliebter Aufenthaltsort berühmter Künstler und auch populäre Sommerfrische für betuchte Wiener:innen. Im Zweiten Weltkrieg aber haben die Nationalsozialisten in der Seegrotte, einer der Hauptattraktionen der Hinterbrühl, Jagdflugzeuge herstellen lassen - von hunderten Zwangsarbeitern, die in einem eilig errichteten Außenlager des KZs Mauthausen ein elendes Dasein fristeten, Misshandlungen und Hunger leiden mussten.
Kurz vor Kriegsende, am 1. April 1945 wurden an die 1.900 Lagerinsassen aus der Hinterbrühl nach Mauthausen getrieben, hunderte Menschen starben auf diesem Todesmarsch oder wurden schon vorher ermordet, weil sie marschunfähig waren.
In den Jahrzehnten nach dem Krieg wollte die Gemeinde von ihrer dunklen Vergangenheit nichts mehr wissen. Das hat sich geändert, es gibt auch eine KZ-Gedenkstätte; allgemein bekannt ist die NS-Geschichte aber noch nicht. -
Die Gletscher sind die Fieberthermometer des Klimawandels. Bis zum Ende des Jahrhunderts, so schätzen Expert:innen, werden in der Schweiz fast alle Gletscher geschmolzen sein. Mit ihnen verschwindet ein prägender Teil der Schweizer Natur- und Kulturlandschaft, Lebensräume verändern sich. Was außer Wasser verlieren wir, wenn die Gletscher verschwinden?
In Gletscherbächen hat ein Schweizer Forschungsteam gerade eine erstaunliche Vielfalt an Bakterien entdeckt - Biodiversität, die zusammen mit den Gletschern zu verschwinden droht. Und während Glaziologen das rasante Schmelzen des "ewigen Eises" vermessen, suchen Künstlerinnen auch nach neuen Wegen, den Wandel sichtbar zu machen. -
80 Jahre nach Ende der Nazi-Diktatur gibt es immer weniger Menschen, die diese Zeit noch erlebt haben und davon berichten können. Die meisten NS-Verfolgten, die heute noch leben, waren zwischen 1938 und 1945 Kinder oder Jugendliche. Sie waren auf ganz unterschiedliche Weise vom Nazi-Terror betroffen: Eltern wurden ermordet, sie selbst diskriminiert und deportiert, einige überlebten in Verstecken oder im Exil. Darüber zu reden, gelingt vielen erst heute.
Als Zeitzeug:innen gehen sie in Schulen, um Schüler:innen die Nazi-Gräuel auf persönlicher Ebene näherzubringen und vorbeugend gegen Antisemitismus und Rassismus zu wirken. Aber interessiert das junge Menschen von heute überhaupt noch? -
Im Buwog-Berufungsprozess hat der Oberste Gerichtshof sein Urteil gefällt: Das erstinstanzliche Untreue- und Geschenkannahmeurteil gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser wurde bestätigt, das Strafausmaß aber auf vier Jahre Freiheitsstrafe halbiert. Auch für einige andere Angeklagte wurde das Strafmaß verändert. Das letztinstanzliche Urteil fiel damit 21 Jahre, nachdem die Bundeswohnungen privatisiert wurden, 16 Jahre, nachdem die Ermittlungen begonnen haben und acht Jahre, nachdem das Verfahren in erster Instanz begonnen hat.
Wie sind die Urteile einzuschätzen, ist die lange Verfahrensdauer allen Beteiligten zumutbar? Welche Konsequenzen müssen Politik und Justiz daraus ziehen? Und was muss Österreich in der Korruptionsbekämpfung tun?
Darüber diskutieren:
Michael Dohr, Rechtsanwalt, Verteidiger von Walter Meischberger
Renate Graber, Journalistin Der Standard
Georg Krakow, Transparency International
Ashwien Sankholkar, Journalist Dossier, Buwog-Aufdecker -
Bei der deutschen Wahl Ende Februar hat die AfD, eine in Teilen rechtsextreme Partei, ihren Stimmenanteil gegenüber der Wahl zuvor verdoppelt – auf 20,8 Prozent.
Sie verdrängte damit die Sozialdemokraten vom zweiten Platz und liegt nun hinter der Union aus CDU und CSU. Noch deutlicher war das Ergebnis in jenen Bundesländern, die einst die DDR bildeten. Dort hat sich die Landkarte komplett blau eingefärbt, mit Ausnahme der Großstadt Berlin wurde die AfD zur stärksten Partei.
Warum hat die Rechte gerade in den Regionen solchen Zulauf, die einst Teil einer Diktatur waren, noch dazu einer, die sich betont antifaschistisch gegeben hat?
Der deutsche Historiker und Autor Ilko Sascha Kowalczuk ist selbst in der DDR aufgewachsen und hat unter der SED-Diktatur gelitten.
Kürzlich war er in Wien – auf Einladung des Renner-Instituts der SPÖ - und hat darüber referiert, warum im Osten Deutschlands die AfD so stark ist.
Stefan May fasst die Veranstaltung zusammen. -
Vor zehn Jahren fand das erste „Internationale Literaturfestival Odessa“ statt. Damals hatte Russland zwar schon die Ostukraine angegriffen und die Krim annektiert – aber noch trafen sich am Schwarzen Meer ukrainische und russische Schriftsteller:innen, um über die Ursachen und Folgen der Angriffe zu diskutieren. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich, denn der Gesprächsfaden zwischen russischen und ukrainischen Kulturschaffenden ist abgerissen, die Altstadt von Odessa immer wieder Ziel von russischen Raketenangriffen. Drei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine fand das ILO nun Ende Februar im polnischen Krakau statt. Der Strategiewechsel der USA unter Donald Trump beschäftigt Schriftsteller, Flüchtlingshelferinnen und Ukrainer im Exil.
-
Stefanie Fenkart, Friedensforscherin, International Institute for Peace
Gustav Gressel, Militärexperte, Landesverteidigungsakademie
Reinhard Marak, Krisenmanagement und Sicherheitsvorsorge, WKÖ
Klaus-Heiner Röhl, Ökonom, Institut für die Deutsche WirtschaftDiskussionsleitung: Paul Schiefer
-
In memoriam Mathilde Schwabeneder (Gestaltung)
Schon im Mittelalter hatten sich Juden in Südtirol niedergelassen. Ihre Blütezeit erreichte die Gemeinde in den letzten Jahrzehnten der Habsburgermonarchie. So trugen jüdische Ärzte ganz wesentlich zum Erfolg der Kurstadt Meran bei und verhalfen ihr zu internationalem Ruhm.
Die faschistischen Rassengesetze 1938 und der Einmarsch der Nationalsozialisten im September 1943 setzen alldem jedoch ein brutales Ende. Jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen wurden denunziert, vertrieben, deportiert. Heute zählt die jüdische Gemeinde in Meran wieder rund 50 Mitglieder. Die Aufarbeitung ist jedoch noch lange nicht zu Ende. „Es war ein Tabuthema, von dem man nicht einmal erkannt hatte, dass es ein Tabu ist“, sagt Peter Langer, Sohn von Überlebenden. -
Vor genau fünf Jahren hat die damalige Bundesregierung drastische Maßnahmen angekündigt, um die Zahl der COVID-Infektionen einzuschränken. Ab 16. März 2020 ging Österreich in den ersten harten Lockdown – das Land stand plötzlich still. Man durfte nur mehr in Ausnahmefällen die Wohnung verlassen, keine Angehörigen und Freunde mehr treffen; Schulen, Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken, Lokale und Kulturbetriebe wurden geschlossen.
Mehr als drei Jahre hielt die Pandemie Österreich und die Welt in ihrem Bann, mit gravierenden Auswirkungen in vielen Bereichen. Die Risse in der Gesellschaft sind bis heute nicht gekittet, vielleicht auch, weil sie politisch instrumentalisiert werden.
Die Corona-Pandemie war auch die Zeit der Expert:innen: Plötzlich waren Virologinnen, Mikrobiologen und Mediziner:innen gefragte Interviewpartner. Wie sehen sie die Pandemie heute? Ein Rückblick und eine Bestandsaufnahme. - Laat meer zien